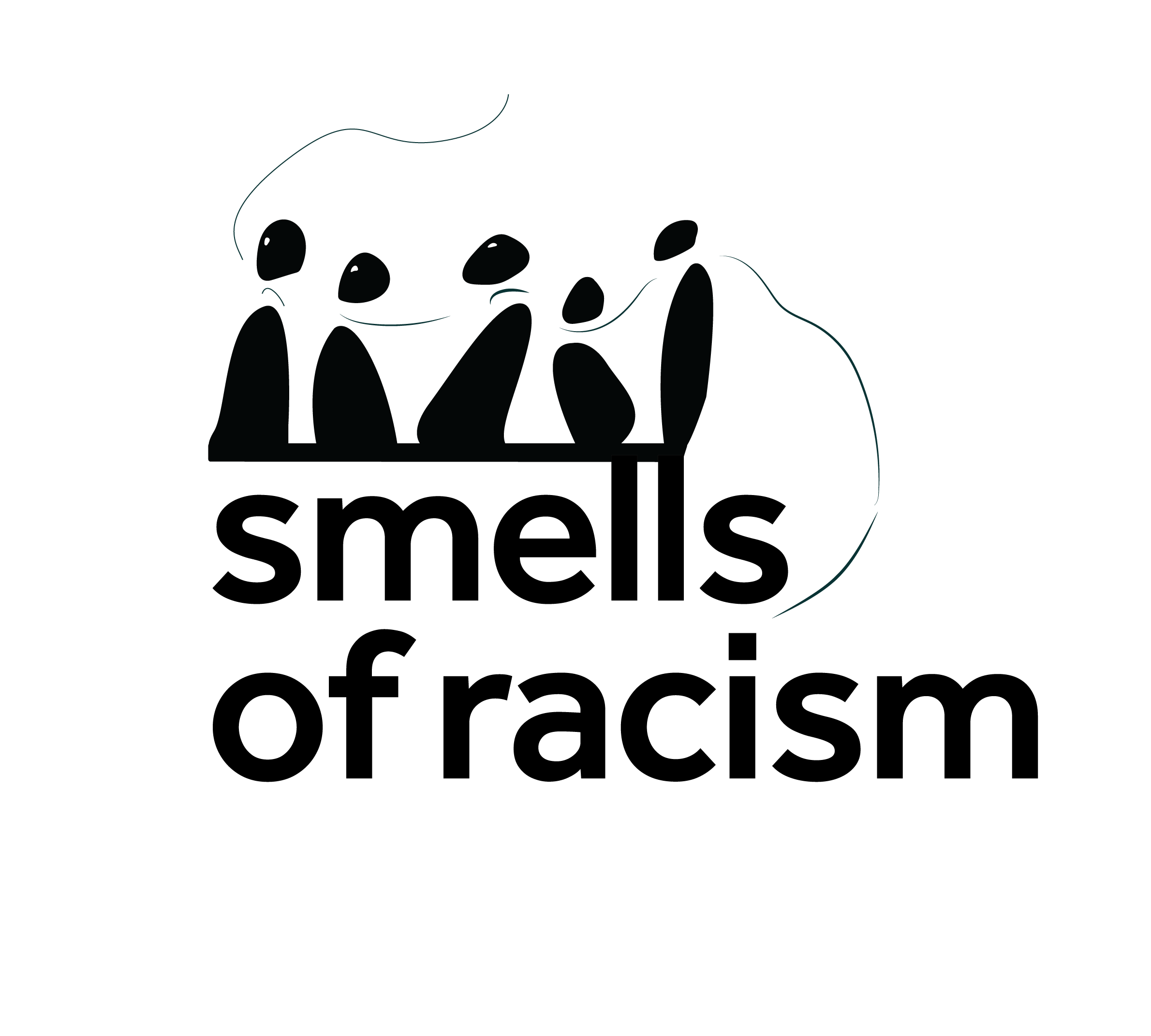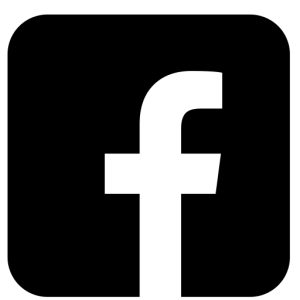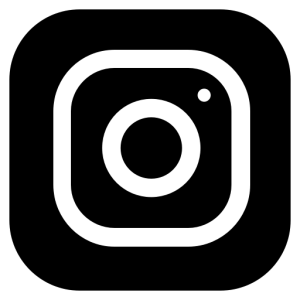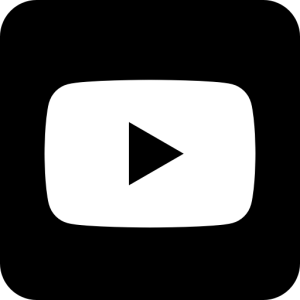Wie riecht Rassismus und was wird gerochen? Von alltäglichen Vorurteilen bis hin zu den philosophischen Ausführungen Immanuel Kants über die Verbindung von Geruch und “Rasse” hat der Konnex von Rassismus und Geruch eine lange (abendländische) Tradition. Das installative und partizipative Performance-Projekt SMELLS OF RACISM setzt sich mit diesen Themenkomplexen künstlerisch wie wissenschaftlich auseinander.
Rassismus hat seit langem eine olfaktorische Seite, die allerdings (zu) selten Beachtung findet. Der Geist des Rassismus wie wir ihn bis heute verstehen, spukt mindestens seit der europäischen Aufklärung. So artikulierte beispielsweise einer der berühmtesten Philosophen dieser Zeit, Immanuel Kant, eine direkte Verbindung zwischen schlechtem Körpergeruch und dunkler Hautfarbe. Bis heute ist der Konnex von kulturellen Unterschieden und Gerüchen nicht gefeit vor rassistischen Zuschreibungen. Betroffene berichten von Beschwerden der Nachbarn wegen “unangenehmer” und “zu intensiver” Gerüche, von erschwerter Wohnungssuche auf Grund der “exotischen” Küche, oder auch direkten Beleidigungen aufgrund von angeblich unangenehmen Körperdüften.
So sehr Gerüche im Kontext des Rassismus relevant sind, so sehr gibt es in unterschiedlichsten Religionen und kulturellen Praktiken zahlreiche rituelle und spirituelle Bedeutungen und Verwendungen von Düften, bei denen die Vertreibung des Bösen oder der Schutz vor bösen Geistern zentral ist. An dem Punkt der rassistischen Deutung von Gerüchen einerseits und der (auch kulturell) heilenden Kraft von Gerüchen andererseits setzt SMELLS OF RACISM an.
SMELLS OF RACISM ist eine performative und partizipative Installation, die sich in mehrere „Stationen“ mit unterschiedlichen thematischen Schwerpunkten – basierend auf einem breitgefächerten Recherchematerial – gliedert. Diese Stationen bestehen aus dokumentarischen Berichten zu rassistischen Anfeindungen aufgrund von speziellen Gerüchen, mythologischen Erzählungen über gefährliche aber auch heilende und befreiende Wirkungen von Gerüchen wie z.B. lokale (alpenländische) Traditionen des schützenden Räucherns in den Rauhnächten, biografischen Berichten der Performer:innen, sowie einem tänzerischen Geruchsarchiv (tänzerische Übersetzungsprozesse von Geruchserfahrungen).
Zuschauer:innen können sich frei durch die Installation bewegen und sich aktiv beteiligen. In Gesprächen, Notizen und körperlicher Interaktion werden sie von den Performer:innen eingeladen, sich selbst in eine aktive Auseinandersetzung mit den eigenen Erfahrungen und/oder auf Beobachtungen rund um das Thema Rassismus/Rassismuserfahrungen und darauf aufbauend Geruch und Rassismus zu begeben.